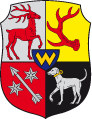Ferner bemerkt Feldmann, als Entgegnung zu Georg Feders Ansichten, im Handbuch der evangelischen Kirchenmusik den „Verfall“ der Kirchenmusik, zu der auch Hoffmann gehöre: Eine Beurteilung der Werke Hoffmanns sei erst später möglich. „bis zu einer genaueren Analyse dieser Quellen wird man mit Urteilen wie ‚leeres Figurenwesen‘, ‚derbe Kontrastmalerei‘ dem
neuen Stil, wie ihn Mattheson lehrte, nicht gerecht. Der Begriff des ‚Verfalls‘ führt leicht dazu, das Positive – mag es auch schwacher vertreten sein – zu übersehen“. Er weist Feders negative Bewertung der Kantate in der evangelischen Kirchenmusik dieses Umkreises – die Werke von J.G. Hoffmann inbegriffen – zurück und hofft auf eine bessere und angemessenere Einschätzung der Kompositionen Hoffmanns.
Einen Neuansatz in der Beurteilung dieses Komponisten – auch wenn er den Choralsatz nicht mehr als Fundament benutzt – wagt Feldmann aber nicht, obwohl schon Johann Gottfried Walther in seinem Musicalischen Lexicon von 1732 über Hoffmann schreibt, er sei ein „beliebter Componist“. Es darf schon jetzt darauf hingewiesen werden, daß J. G. Hoffmann die Größe Telemanns, den weitberühmten Autor, am Beginn seiner kompositorischen Tätigkeit hervorhebt, daß er Telemanns Art aber nicht einfach folgt, sondern in seine eigene Kompositionsweise hineinnimmt. Hoffmann ist einer der interessantesten Komponisten in Schlesien zur Zeit J. S. Bachs und Telemanns, dessen Werke wieder zu Gehör zu bringen sich lohnt. Schon Feldmann hat etwa 1938 in der evangelischen Kirchenmusikschule zu Breslau die Weihnachtskantate Hoffmanns unter „allgemein Beifall“ aufgeführt.
Johann Gottfried Mentes überzeugende generalbaßbegleitete Gamben- Suite von 1754 steht dem galanten Stil eher näher als der durchgängige kontrapunktischen Durcharbeitung Bachs, ohne daß gattungsmäßige oder stilistische Einwirkungen Telemanns (bis jetzt) dingfest gemacht werden könnten. Anders steht es mit seinem 1742 zusammengestellten Schlesisch- Harmonischen Jubel-Klang. Einige Übereinstimmungen mit Telemanns Musique de Table (Tafelmusik) von 1733 sind rasch erkennbar: die Zusammenstellung von Kompositionen verschiedener Gattungen, allerdings als geschlossene Gruppen und nicht zusammengestellt in festen Reihen verschiedenen Charakters wie bei Telemann, die Kombination von orchestralen und instrumental-solistischen Werken, die stets wechselnden instrumentalen Besetzungen, sowie am Anfang eine zweiteilige Ouvertüre, im Notentext Introduzzione genannt, in der am Schluß der erste Satz wieder aufgenommen wird, und am Ende eine in den Stimmen betitelte Conclusione. Mente berücksichtigt Suiten und ausgesprochen „Quatuors“ nicht, dafür ist ein Echo a doi Chori nach den 12 Concerten eingeschoben, die dem Concerto grosso zuzuzählen sind. In den Concerti sind aber suitenartige Sätze enthalten, so daß suitenhafte Züge doch vorhanden sind. In den letzten sieben Concerti liegt ein anderer zyklischer Typus vor, der mehr als drei Sätze und besonders gern suitenartige Sätze aufweist, nämlich neben Minuetta (samt Trio) die Gavotta und Giga, das Scherzo beziehungsweise Scherzando und auch die Polonaise (nur abgekurzt Polon. geschrieben), die Telemann ebenfalls gern verwendet. Es ist aber offenzulassen, ob Mente in der Polonaise Telemann oder eigenen Hörerfahrungen in Schlesien oder der unmittelbaren Nachbarschaft folgt. Im Gegensatz zu dem in Breslau 1692 geborenen, dort ausgebildeten und ab 1727 in Hirschberg im Riesengebirge wirkenden Reimann sind bei Mente, wie bei Telemann, auch Einflüsse des polnischen Tanzes nachweisbar. Zwar hat Käte Schaefer-Schmuck schon 1934 in ihrer Dissertation auf Einflüsse polnischer Musik in einigen Stücken von Telemanns Fantaisies pour le clavessin hingewiesen. Beziehungen zur polnischen Musik sind aber in Reimanns Ariosen überhaupt nicht vorhanden. Die Art des Ariosos sperrt sich dagegen von vornherein. Es kann aber auch damit zusammenhängen, daß die Polonaise im Riesengebirge im 18. Jahrhundert nicht heimisch war.